
Der Pitzengraben – Ein Kleinod mit viel Geschichte
Pitzengrabengeschichte 1: Keine Kohlen zu holen
Hier im Pitzengraben trifft man wiederum auf Gosauschichten. Es ist vor allem mürber, grauer Sandstein. Nur über dem Eingang zum ehemaligen kleinen Bergwerksstollen tritt eine dünne, schwarze Lage von kohlehaltigem Ton auf. Dieser sollte dort gewonnen werden, allerdings mit wenig Erfolg. Wie alle Kohle ist auch diese aus den Resten von Pflanzen entstanden. Ein Fluss schwemmte sie vor 90 Millionen Jahren in das seichte Meer. Unter Wasser vermoderten die Pflanzen nicht. Der Druck der ursprünglich darüber gelegenen Gesteinsschichten, die höheren Temperaturen in der Tiefe und nicht zuletzt die bedeutende Zeit, die seither vergangen ist, haben die Pflanzen in der Folge zu der Kohle umgewandelt. Da allerdings von Anfang an viel Ton zusammen mit den Pflanzenresten abgelagert worden ist, und die Umwandlung nur gering war, ist die Kohle hier sehr minderwertig.
Pitzengrabengeschichte 1: Keine Kohlen zu holen
Hier im Pitzengraben trifft man wiederum auf Gosauschichten. Es ist vor allem mürber, grauer Sandstein. Nur über dem Eingang zum ehemaligen kleinen Bergwerksstollen tritt eine dünne, schwarze Lage von kohlehaltigem Ton auf. Dieser sollte dort gewonnen werden, allerdings mit wenig Erfolg. Wie alle Kohle ist auch diese aus den Resten von Pflanzen entstanden. Ein Fluss schwemmte sie vor 90 Millionen Jahren in das seichte Meer. Unter Wasser vermoderten die Pflanzen nicht. Der Druck der ursprünglich darüber gelegenen Gesteinsschichten, die höheren Temperaturen in der Tiefe und nicht zuletzt die bedeutende Zeit, die seither vergangen ist, haben die Pflanzen in der Folge zu der Kohle umgewandelt. Da allerdings von Anfang an viel Ton zusammen mit den Pflanzenresten abgelagert worden ist, und die Umwandlung nur gering war, ist die Kohle hier sehr minderwertig.
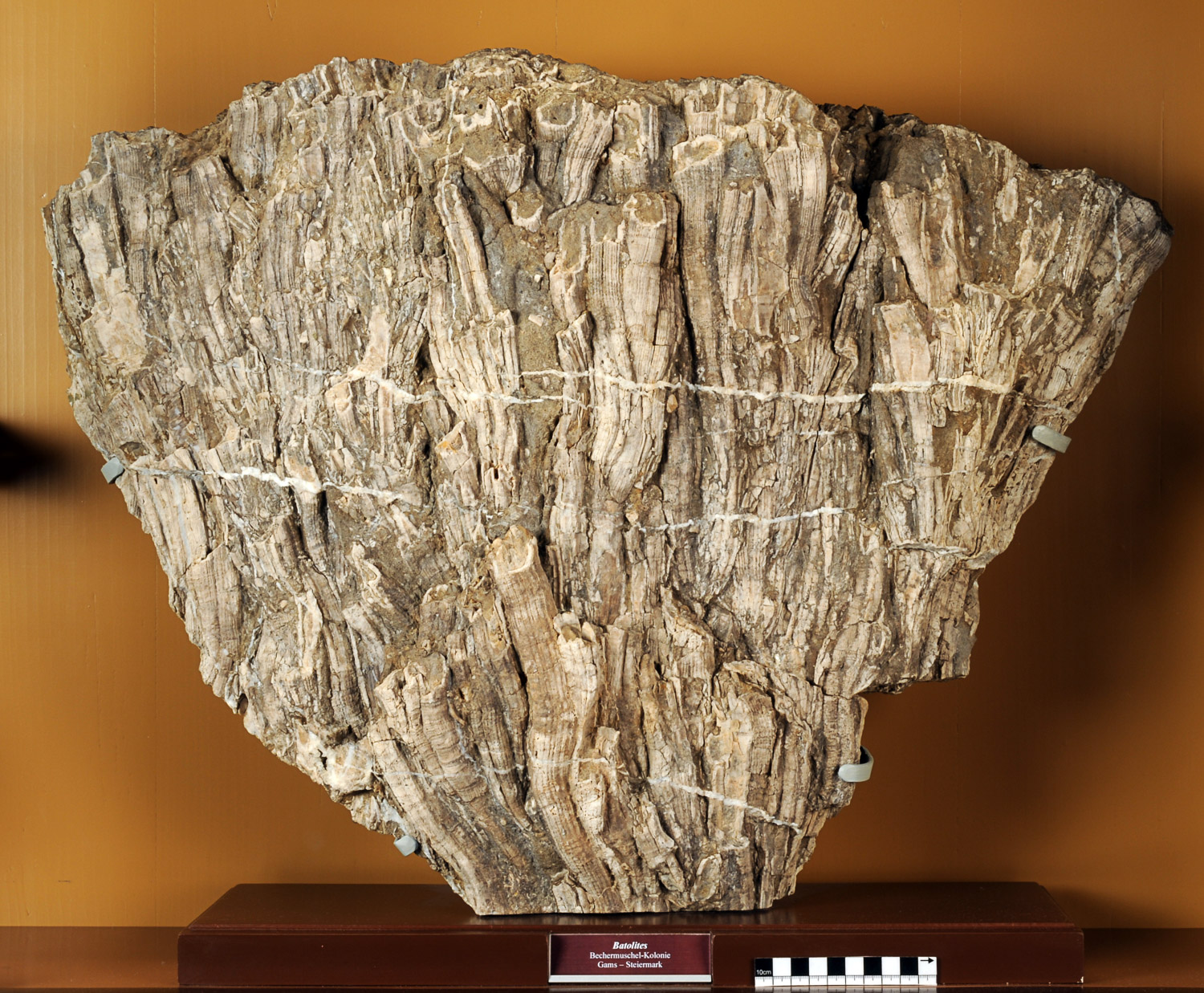

Pitzengrabengeschichte 3: Die Schneckenkatastrophe
Auch im Pitzengraben finden sich eine Ansammlung von Schneckenfossilien. Gelebt haben sie vor zirka 90 Millionen Jahren. Sie haben im seichten Meer und Sand gelebt. Sobald Gehäuse von Sturmwellen freigelegt wurden, sind Bohrschwämme darüber hergefallen. Die meisten Schneckenhäuser sind deswegen total zerfressen und durchlöchert. Die Art von Schnecken wurde bereits 1832 in die Wissenschaft eingeführt und ist damit das erste aus Gams bekannte Fossil. Sie heißt Trochactaeon lamarcki und ist nach dem Franzosen Jean Baptist Lamarck benannt. Er war einer der ganz großen Theoretiker der Vererbungslehre. Er vermutete, dass neue Tier- und Pflanzenarten durch die Anpassung ihrer Vorfahren an die geänderte Umwelt entstanden. Damit war er im krassen Gegensatz zu seinem Kontrahenten Charles Darwin, der die Veränderungen der Tier- und Pflanzenwelt ausschließlich auf genetischer Änderungen zurückführte. Der Kampf der Anhänger tobte fast ein Jahrhundert. Heute wissen wir, dass beide Herren Recht hatten. Jeder allerdings nur zum Teil, denn Arten entstehen durch die Auswahl der genetisch für ihre Umwelt am besten geeigneten Formen.
Pitzengrabengeschichte 4: Gamser Fossilienfunde
- Megalonoda reussi von der Schönleiten in Gams wurde 1860 durch Moriz Hörnes, nach August Emanuel Reuss benannt. Er war einer der bedeutendsten Erforscher der Kreideablagerungen Mitteleuropas, unter anderem des Gamser Beckens. Moriz Hörnes war Wissenschaftler am k.k. Hofmineraliecabinets, einem Vorläufer des heutigen Naturhistorischen Museums in Wien. Das Original befindet sich in der Sammlung der Geologischen Bundesanstalt in Wien.
- Barroisiceras haberfellneri stammt vom Radstatt, südlich von Gams. Der Ammonit wurde von Josef Haberfellner, einem Beamten der Vordernberger Radwerke und eifrigen Fossiliensammler gefunden. Franz von Hauer, ein an der Geologischen Reichsanstalt in Wien wirkender international anerkannter Fachmann, hat die Art beschrieben und nach Haberfellner benannt. Das Original wird in der Geologischen Bundesanstalt in Wien aufbewahrt.
- Neocylindrites gosaviensis. Diese Schneckenart fand Heinz Kollmann vom Wiener Naturhistorischen Museum an einer neu gebauten Straße auf die Schönleiten. 1967 beschrieb er sie in einer wissenschaftlichen Abhandlung. Neocylindrites war vorher aus Frankreich bekannt und erstmals wurde diese Gattung auch in Österreich gefunden. Die neue Art heißt „gosauischer Neocylindrites“. Das Originalstück befindet sich im Wiener Naturhistorischen Museum





